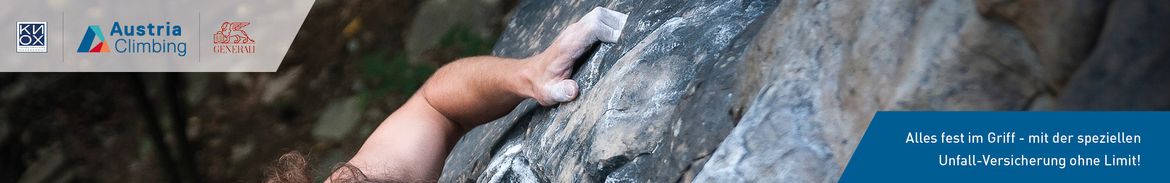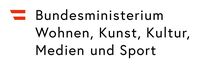Das Körpergewicht spielt im Klettern eine bedeutende Rolle und manche Athlet:innen versuchen, sich durch eine Gewichts-Reduktion einen kleinen, aber essenziellen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen. Im ersten Moment ist das nicht verwerflich – dennoch ist langfristig gesehen große Vorsicht geboten.
Der Kletterverband Österreich, insbesondere Präsident Dr. Eugen Burtscher (Mitglied der MedCom der IFSC), nimmt seit mehr als zehn Jahren eine wichtige Rolle in dieser Thematik ein und zählt in Sachen Messungen und langfristiges Monitoring zu den weltweiten Vorzeigeverbänden.
Früher war in den Routen die Komponente Ausdauer am essenziellsten und es waren immer wieder sehr magere Athlet:innen zu beobachten. Durch die Verkürzung der Kletterzeit mit mehr Augenmerk auf Maximalkraft, Koordination und Schnelligkeit, hatte sich die Gewichtsthematik kurzfristig etwas entspannt. Mit der Aufnahme des Klettersports in das olympische Programm war wieder vermehrt zu beobachten, dass viele Athlet:innen sich wieder im sogenannten Grenzbereich bewegen. „Ein geringes Gewicht kann ein Vorteil sein, man bedenkt aber ab einer kritischen Grenze nicht die langfristen gesundheitlichen Schäden“, erläutert Burtscher und ergänzt: „Wir messen auch in der Jugend den BMI (Anm.: Body Mass Index) und sehen so, ob ein kritisches Verhältnis zwischen Körpergröße und Gewicht vorherrscht. Sollte es Auffälligkeiten geben, werden Eltern, Ärzte, Sportpsychologen und Diätologen kontaktiert, damit wir schnell eingreifen und an den richtigen Stellschrauben drehen können. Das funktioniert in Österreich wirklich gut. Der Prozess wurde bereits erfolgreich vor meiner Zeit angestoßen.“
Neben den angesprochenen Messungen wird in Österreich auch mit Workshops und Vorträgen präventiv gearbeitet, regelmäßig für die Problematik sensibilisieren und die Sportler:innen intensiv begleitet sowie unterstützt. Während Österreich, Deutschland, Frankreich und die nordischen Länder an einem Strang ziehen, geben andere Nationen diesem Thema weniger Relevanz.
Sensibler Bereich
Ein Gewicht im kritischen Bereich kann zu schwerwiegenden gesundheitlichen Folgen führen, die oftmals nicht mehr rückgängig gemacht werden können. Dies wird in wissenschaftlichen Studien als „Relative Energy Deficiency in Sport“ (RED-S) bezeichnet. Dabei werden viele wichtige Körperfunktionen beeinträchtigt wie z. B. Knochenstoffwechsel, hormoneller Stoffwechsel, Immunsystem, Herz-Kreislauf-System sowie psychologische Gesundheit. Ständiges Untergewicht kann schließlich auch zu irreversiblen Wachstumsverzögerungen führen. Der Weg von einem gestörten Essverhalten über eine konkrete Essstörung bis hin zur Anorexia nervosa (Magersucht) ist fließend. Das ist in den meisten Fällen ein kontinuierlicher Weg nach unten, sodass der Kreislauf stabil bleibt und der Körper sich den Gegebenheiten anpasst. Das Problem ist, dass es vielen Leistungssportler:innen egal ist, was in fünf bis zehn Jahren ist.
„Aktuell können wir nur Empfehlungen aussprechen, haben jedoch keine Handhabe, Athletinnen und Athleten auf internationaler Ebene zu stoppen. Wichtig ist, dass man eine Regelung findet, dass alle Sportlerinnen und Sportler unabhängig von der Ausgangssituation starten können. Möglich wäre auch ein Handicap wie es auch in anderen Sportarten gibt. So könnte beispielsweise ein Zusatzgewicht für sehr magere Athlet:innen dazu führen, dass diese versuchen, besser Muskelmasse aufzubauen, statt sich mit dem Zusatzgewicht herumzuärgern. Das ist einer der Ansätze, die funktionieren könnte. Wichtig ist, dass die Entwicklung des Klettersports mit einem „gesundes Körpergewicht “ ermöglicht wird“, erklärt der KVÖ-Präsident.
Wissenschaftliche Erhebungen als wichtige Grundlage
In den letzten zwei Jahren wurden viele wichtige Daten für eine zukünftige Regulierung erhoben, die zeigen, dass die IFSC diesen Themenkomplex wieder intensiver auf dem Schirm hat:
- Die wissenschaftliche Umfrage „Prevalence of amenorrhea in elite female competitive climbers“, an der 2021 Athletinnen aus 32 Nationen teilnahmen, wurde im Sommer 2022 veröffentlicht. Einige Ergebnisse weisen auf einen dringenden Handlungsbedarf hin: Ca. 14 % der Athletinnen geben eine Essstörung an und 16 % haben keine Regelblutung.
- 2022 wurde bei den Weltcups in Innsbruck eine wissenschaftliche Studie über die Anthropometrie (Körpermaße) von Prof. Dr. Wolfram Müller durchgeführt. Dabei verwendete man ein neuartiges Ultraschallverfahren, um das subkutane Gewebe (SAT) auf möglichst genaue Weise zu erfassen. „So niedrige Werte des Unterhautgewebes (SAT) habe ich bei keiner anderen Sportart festgestellt“, so Müller.
- Fettgewebe fungiert auch als ein wichtiges hormonelles Organ und darf nicht nur als Ballast angesehen werden. Unter einer gewissen Grenze haben speziell Athletinnen mit einer hormonellen Störung zu rechnen, so Burtscher.
Die erhobenen wissenschaftlichen Daten sollen möglichst rasch zu einer guten Reglementierung im internationalen Klettersport verhelfen. „Ich denke, es wird noch ein bis zwei Jahre dauern, bis da im großen Stil etwas passieren wird. Eventuell werden gewisse Regelungen heuer noch implementiert, aber nur wenn sich ein internationaler Konsens finden lässt. Einige Nationen steigen mit dem Argument ‚das kann man nicht vor Olympischen Spielen machen‘ auf die Bremse. Aber man würde immer einen Grund finden, warum es gerade jetzt nicht geht. Meiner Meinung nach muss eine schnellstmögliche Lösung her. Der Ball liegt beim internationalen Kletterverband, ich bin gespannt, in welche Richtung es gehen wird“, unterstreicht der KVÖ-Präsident die Wichtigkeit des Themengebietes. Der Prozess ist nun angestoßen, und international hat die IFSC MedCom nun umfangreiche wissenschaftliche Daten vorliegen, um die kritischen BMI-Grenzen beim Klettern zum Wohle der Athlet:innen zu korrigieren.
Aber auch auf Sportler:innen-Seite ist die Problematik bekannt. Man wartet auf eine Entscheidung und eine Anpassung des Reglements. Das hat auch Olympiasiegerin Janja Garnbret bei einem Zusammentreffen im November in Turin klar unterstrichen.